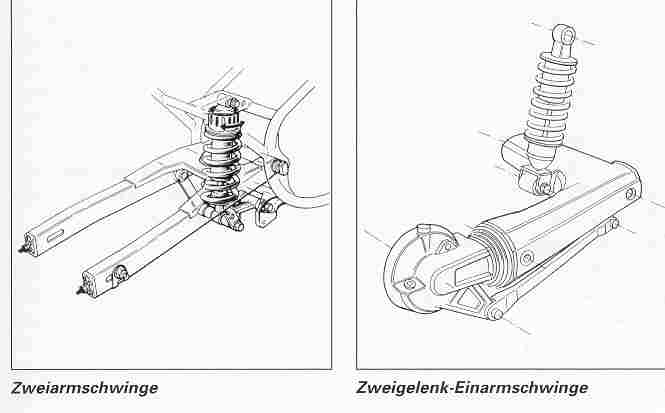Die Hinterradaufhängung ist deutlich einfacher
aufgebaut als ihr vorderes Pendant - schließlich muss das Hinterrad ja nicht
lenken. Zudem sind Radführung, Federung und Dämpfung hinten voneinander
getrennt, während die Telegabel alle Funktionen übernimmt. Standard ist bei
der Hinterradaufhängung die Zweiarmschwinge, Einarmschwingen sind eher die
Ausnahme. Bei Motorrädern mit Kardanantrieb gibt es spezielle Konstruktionen
wie das Paralever von BMW, eine zweigelenkige Schwinge mit Momentausgleich,
die unerwünschte Fahrwerksreaktionen beim starken Beschleunigen eliminieren
soll.
Bei der Zweiarmschwinge führt zu beiden Seiten des Rades ein
Schwingenarm aus Rund- oder Rechteckrohren oder aus Strangpressprofilen von
der Schwingenlagerung zur Hinterachse. Die Schwinge besteht aus Stahl oder
Aluminiumlegierungen, Schweißkonstruktionen oder Gussteile verstärken die
beiden Arme. Schwingen sind heute erheblich massiver als noch vor 20 Jahren.
Das liegt zum einen an den deutlich stärkeren Motorradmotoren, zum anderen
an den höheren übertragbaren Kräften moderner Reifen und schließlich auch an
den Federungssystemen. Denn bei vielen aktuellen Motorrädern greifen nicht
mehr zwei Federbeine in der Nähe der Radachse an, sondern ein
Zentralfederbein direkt oder über Hebelumlenkungen im Bereich der
Schwingenlagerung. Durch all diese Faktoren wirken weit höhere Kräfte und
Biegemomente auf die Schwinge als noch vor zwanzig Jahren.
Bei der Einarmschwinge führt nur auf einer Seite des Rads ein
Schwingenarm von der Schwingenlagerung zur Radachse. Die meisten
Einarmschwingen bestehen aus Aluguss; auf ihren Schwingenarm wirkt im
Gegensatz zur Zweiarmschwinge bereits bei Geradeausfahrt ein Torsionsmoment.
Deswegen müssen sie steifer sein, was sich meist in einem höheren Gewicht
niederschlägt. Vorteile bringt die Einarmschwinge beim Ausbau des Rads, das
oft von einer zentralen Radmutter gehalten wird und sich schnell und
problemlos nach einer Seite abnehmen lässt.
Bei Motorrädern mit Kardanantrieb wirkt sich das Antriebsmoment am
Hinterrad stark auf das Fahrverhalten aus. Es stützt sich über das
Kardangehäuse an der Schwinge ab und verursacht damit ein Drehmoment um die
Radachse, das so genannte Reaktionsdrehmoment. Dadurch hebt sich das
Motorrad beim Beschleunigen aus den Federn, und zwar umso stärker, je höher
das Antriebsmoment am Hinterrad ist. Deswegen sind die Kardanreaktionen in
den unteren Gängen stärker als in den oberen. Einige Hersteller versuchen
diese Eigenart durch längere Schwingen zumindest einzuschränken. BMW und
Moto Guzzi bekämpfen den lästigen Fahrstuhleffekt mit zusätzlichen
technischen Aufwand: Die Kardangehäuse sind gegenüber dem Schwingenarm
zusätzlich gelenkig gelagert und stützen sich über eine separate Strebe am
Rahmen ab. Abhängig von der Geometrie des dadurch entstehenden
Parallelogramms lässt sich mit der Zweigelenk-Einarmschwinge der BMW und der
Zweigelenk-Zweiarmschwinge der Guzzi ein Aufstellen unter Last nahezu
vollständig verhindern.
Auch bei Sekundärantrieben wie Kette oder Zahnriemen wirken unter Last
Reaktionskräfte auf die Hinterradaufhängung. Je nach Position der Schwinge
und der Lage von Ritzel und Schwingenlagerung lassen sie das Motorrad ein-
oder ausfedern. Sie machen sich aber deutlich weniger bemerkbar als beim
Kardanantrieb.
Dokument in PDF